Corona: Digitalisierung. Gescheitert.
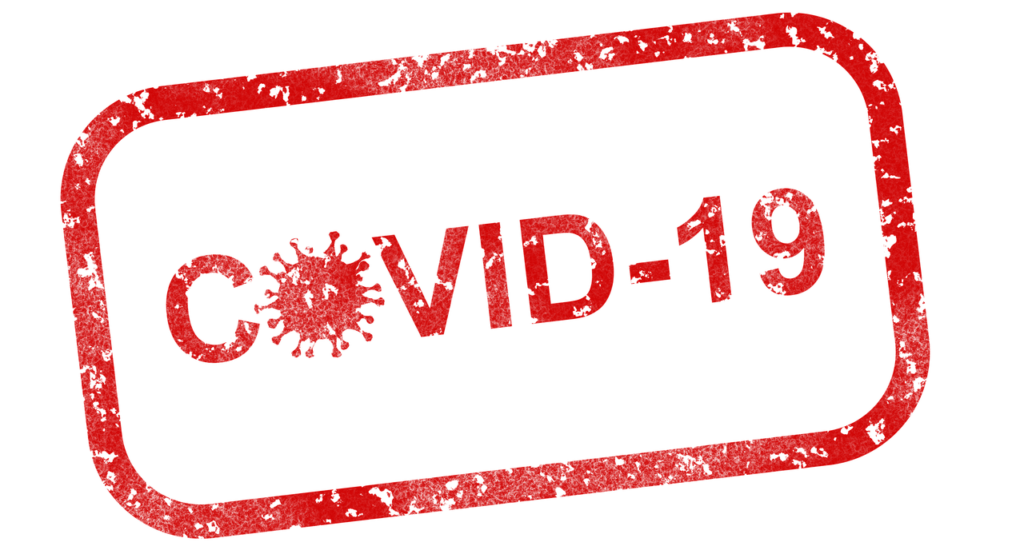
Corona: Pandemiebeispiele schon 2013
Schon Jahre zuvor ausgearbeitet, welche Folgen eine Pandemie hat. Darauf aufbauend, wären mögliche Verfahrensweisen schnell abzuleiten gewesen. Der Regierung lag 2013 die Drucksache 17/12051 vor, in der die Corona-Pandemie als mögliches Seuchen-Szenario vorweggenommen wurde. Diese Drucksache basiert auf einer Studie, die mit unseren Steuergeldern finanziert ist. In Anbetracht der Tatsache, dass unsere Regierung (insbesondere: die Bundeskanzlerin) diese Studie kennt, zeigt der Umgang mit der Pandemie ziemlich genau, welchen Stellenwert die Menschen in diesem Land haben. Einen Bericht dazu gibt es vom aerzteblatt (Stand 2020). Die möglichen Auswirkungen einer Pandemie sind schon erkannt worden und traten in tatsächlicher Form in Corona auf.
Corona: digitalisierung nicht umgesetzt
Telefonanlagenausfälle, regelmäßger Tausch von Telefongeräten, stundenlange Serverabstürze und nicht funktionierende Software sind nur einige Beispiele von dem was bei den Behörden nicht funktioniert als Folge von Corona. Führungspositionen werden bei Behörden auch von scheidenden Menschen aus anderen Ämtern besetzt (Beispiel: scheidende Soldaten). Diese haben zum Beispiel eine Vorbildung als Wasseraufbereiter, ohne Weiterbildungen für IT-Projekte. Auf der Grundlage des Pandemiebeispiels gibt es eine Software, welche in den Ämtern allerdings keinen Einzug fand. Stattdessen können Ämter selbst entscheiden, welche Software eingesetzt wird. Mit einer geschaffenen Erwartungshaltung, eine gute Software nutzen zu können, ist schnell jegliche Illusion verflogen. Keine einheitliche Einweisung von Zusatzpersonal, kein Abgleich von Adressdatensätzen, keine Informationen bei eingespielten Updates, keine Schnittstellen zu Email oder Dritten. Keine Möglichkeit aus dem Programm zu drucken, bei Eingaben muss man manuell Hinweise beachten, damit weitere Stellen diese verarbeiten können … allein ein Bericht über die Fehler der Software lohnt sich nicht – es wäre niederschmetternd.
Software soll die Arbeit erleichtern und nicht unzählige Sonderfälle beinhalten, welche immer wieder (auch durch Wechsel von Personal) gemacht werden. Besonderes Augenmerk an dieser Stelle gilt den Verantwortlichen, welche internes Personal für IT-Projekte benennt.
Fehlende Konzepte
Stellen wir den Mensch in den Mittelpunkt. Jedes Konzept ohne Betrachtung der Mitarbeiter und der Umgebungsvariablen wird schwierig werden. Dieser braucht für effektives Arbeiten ausreichend Arbeitsplatzleistung für den heutigen Stand der Technik. Das ist wie erwartet nicht der Fall wie man in diesem Bericht nachlesen kann. In zivilen Unternehmen würde man das als Mitarbeiter einfordern, aber im Behördentum ist Rückstand nach wie vor Tagesgeschäft. Man hat hier leider nicht erkannt, dass man die Führungsstruktur ändern muss, um auf schneller werdende Änderungen überhaupt noch reagieren zu können. Das sich die deutschen Behörden (mit wenigen Ausnahmen) überhaupt noch in eine Position begeben könnten, welche agieren zulässt, können wir streichen.
Einführung von vorhandener Software, während diese am dringensten benötigt wird ohne bundeseinheitliche Vorgaben durchzusetzen ist nicht möglich. Hat der Mensch die Wahl wird dieser ganz schnell Probleme finden, welche diese verzögert oder ablehnt. Zwar klingt das sehr paradox, allerings ist die derzeit eingesetze Software – nicht mal das Wort wert. Das bereits vorhandene SORMAS einzusetzen wäre ein guter Plan gewesen, wenn diese den Anforderungen gerecht werden würde. Doch genau hier liegt das Problem, wie im Bericht nachzulesen ist. Von Konzepten ist in dem Ämtern nach wie vor nicht viel zu finden. Stattdessen werden Excelllisten lieber nochmal ausgedruckt, allerdings ist 17 Uhr aber auch schon Feierabend. Bei der Übergabe im Schichtwechsel kann es dann auch dazu kommen, dass Betroffene mehrfach angerufen werden. Infizierte aus anderen Landkreisen bekommen nur eine Information, wenn das Fax rechtzeitig ankommt – eine neumodische Art der Kommunikation: https://video.golem.de/details/16847.html.

Fazit: Es trifft immer die falschen
Abseits von den ganzen Problemen kümmert sich niemand ausreichend um die Menschen die darunter leiden. Das beginnt allerdings nicht erst bei Personen mit psychischen Schwierigkeiten. Es betrifft alle, Individuen die glücklicherweise kaum Beeinträchtigung hinnehmen müssen werden sich zumeist um andere kümmern. Hierbei wird die Solidarität bei Pflegekräften immer größer. Es ändert aber nichts daran, dass das System nicht unnötig viel Geld für dieses ausgeben möchte. Weniger Jobsuchende in diesen Bereichen scheinen nur Gewinne anderer Interessengruppen zu minimieren. Ist das moralisch vertretbar?
